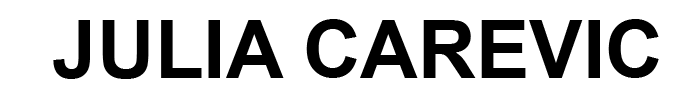Werden wir in zehn Jahren keine eigene Kleidung mehr besitzen, sie lediglich mieten oder untereinander tauschen? Oder werden wir ausschließlich Vintage und Secondhand Stücke, die bereits eine Geschichte erzählen, konsumieren? Wie sieht sie aus, die Zukunft der Mode? Wohl kaum ein anderes Thema wird derzeit in der Modeindustrie so ausgiebig diskutiert, wie ihre eigene Zukunft. Auch wird ihre Daseinsberechtigung in den Medien zunehmend hinterfragt — und das nicht zu Unrecht. Immerhin 10 Prozent der Kohlenstoffemissionen werden durch sie verursacht und dennoch schreckten einige Marken, zu denen auch die britische Luxusmarke Burberry zählte, lange nicht davor zurück, nicht verkaufte Produkte schlichtweg zu verbrennen, statt sie weiterhin zu verkaufen oder wiederzuverwerten. Um dem entgegenzuwirken und die Modeindustrie zunehmend nachhaltiger zu gestalten, gelten derzeit vor allem zwei Ansätze, die sich beide vielmehr auf Konsument*innen, als auf Unternehmen konzentrieren, als besonders vielversprechend: Neben dem aufstrebenden Markt der Secondhand Mode werden so auch Miet-Services als wegweisende Möglichkeit angesehen. Können sich diese Konzepte aber tatsächlich durchsetzen?
Mit Vintage-Mode gegen den Mainstream
Dass Vintage-Mode als Zukunftsmodell gilt, ist durchaus keine Neuigkeit, immerhin gibt es bereits jede Menge Plattformen, auf denen sowohl gebrauchte Designer-, als auch Highstreet-Labels angeboten werden. Zu den beiden Bekanntesten dürften wohl das französische Angebot Vestiaire Collective und die amerikanische Variante The RealReal zählen, die ihren Fokus jeweils auf Luxusmode legen. Doch auch eigenständige Webshops oder Instagram Kanäle bieten mittlerweile — neben stationärem Handel — eine kuratierte Auswahl an sogenannter pre-loved Mode an, teils werden die ausgewählten Stücke, wie etwa bei Farfetch, sogar parallel zu neuer Mode angeboten. Die Tendenz zu gebrauchter Mode mag dabei nicht ausschließlich an einem nachhaltigen Ansatz, sondern auch an dem Wunsch, sich individueller zu kleiden, liegen, wie Virgil Abloh Ende des vergangenen Jahres in einem Interview mit dem Londoner Magazin Dazed sagte und mit dieser Aussage gleichzeitig das Ende von Streetwear verkündete:
„I would definitely say it’s gonna die, you know?“ Abloh said. „Like, its time will be up. In my mind, how many more t-shirts can we own, how many more hoodies, how many sneakers? I think that like we’re gonna hit this like, really awesome state of expressing your knowledge and personal style with vintage—there are so many clothes that are cool that are in vintage shops and it’s just about wearing them. I think that fashion is gonna go away from buying a boxfresh something; it’ll be like, hey I’m gonna go into my archive.“
So sieht der Designer in einzelnen Vintage-Stücken die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit stärker ausdrücken zu können, als es etwa mit herkömmlicher Streetwear möglich sei — und liefert damit einen Aspekt, der in Zeiten von Instagram, also einer Phase, in der es häufig darum geht, so auszusehen, wie die Masse, durchaus plausibel erscheint, denn immerhin entwickeln sich zu jeder Bewegung stets Gegenbewegungen, wie es etwa die „Anti Fashion“-Ära der 90er Jahre bewies.
Dennoch zielt Ablohs Ansatz auf die Menschen ab, die bereits wissen, welche Mode sie konsumieren wollen, nicht aber auf jene, die durch Plattformen wie Instagram glauben, jeden Tag ein neues Kleidungsstück oder einen aktuellen Trend präsentieren zu müssen — ein kurzes Verlangen nach Neuem wird hier viel eher in Fast Fashion gestillt, statt mit einer aufwendigen Suche nach Einzelstücken. Genau an diesem Punkt setzen sogenannte Miet-Service-Modelle an. Sie fanden ihren Anfang bereits vor über zehn Jahren und ermöglichen Konstument*innen einen häufigen Garderobenwechsel, ganz ohne das Risiko, Einkäufe nach kurzer Zeit zu bereuen. Statt sich für den Besitz zu entscheiden, können vermeintliche Traumstücke, je nach System, für einige Tage, Wochen oder Monate in den eigenen Kleiderschrank einziehen, bevor sie dann zurückgegeben werden müssen. Ein Modell, das eigentlich gar nicht so neu ist, wie Emily Farra, Redakteurin der amerikanischen Vogue, im März 2019 schrieb, immerhin sei das Konzept unter Celebrities, Redakteurinnen und Influencerinnen bereits bekannt: So werden diese nicht nur zu besonderen Anlässen, wie etwa einer Abendveranstaltung, sondern auch zu den verschiedenen Modewochen ausgestattet, bevor sie die Kleidung wieder an PR-Agenturen und Designer*innen abgeben müssen. Jenes Leih-Modell sei durch verschiedene Miet-Services nun auch für die breite Masse zugänglich, so Farra.
Mieten statt besitzen
Eines der bekanntesten Modelle ist die amerikanische Plattform Rent the Runway, die als Vorläufer gilt und für 159 US-Dollar monatlich eine breite Auswahl an Trendteilen bietet. Maximal vier Kleidungsstücke können parallel ausgeliehen werden. Ähnliche Konzepte findet man bei Vince Unfold oder Nuuly. Auf dem deutschen Markt begann das Projekt Kleiderei im Jahr 2013 mit dem stationären Handel, bevor es sich auf den Online Handel ausweitet, im Februar 2019 Insolvenz anmeldete und den Onlinehandel schließlich einstellte. Mittlerweile wurde der Ableger Stay Awhile gegründet, der sich auf die Vermietung nachhaltiger Brands konzentriert und, ebenso wie die anderen Konzepte, mit einem monatlichen Abo-Modell funktioniert. Auch die britische Plattform My Wardrobe HQ widmet sich dem Ausleihen von Designerstücken, kauft diese allerdings nicht selbst, sondern setzt auf den Community-Gedanken: Jede*r kann Kleidungsstücke registrieren lassen und diese dann vermieten, abgerechnet wird pro Tag.
Im vergangenen Jahr kam der Miet-Gedanke auch bei größeren Unternehmen und Marken an: Seit Herbst bzw. Winter 2019 testen sowohl Ganni, als auch H&M eigene Modelle aus. So konzentriert sich Ganni mit „Ganni Repeat“ derzeit auf den dänischen Markt, will den Service nach erfolgreicher Testphase jedoch auf den internationalen Markt ausweiten. Das Konzept: Einzelne Kleidungsstücke können für je eine, zwei oder drei Wochen gemietet werden. Ein Lederkleid kostet so beispielsweise zwischen 90 und 178 Euro, der Verkaufspreis selbst liegt bei etwa 535 Euro. Während der Service bei Ganni ausschließlich über die Webseite läuft, fokussiert sich H&M derweil auf den Flagship Store in Stockholm. Hier können alle Mitglieder des Costumer Loyalty Programms zwischen erlesenen Partykleidern, Röcken und „einzigartigen“ Stücken der Conscious Exclusive Kollektionen der Jahre 2012-2019 auswählen und eine Woche lang drei Teile gleichzeitig mieten. Pro Stück müssen Kund*innen etwa 33 Euro zahlen.
Durchaus klingt das Konzept der Miet-Services in der Theorie vielversprechend, immerhin ermöglicht es den temporären Besitz jener Kleidungsstücke, die man sich entweder aus finanziellen oder praktischen Gründen nicht gekauft hätte. Und dennoch weist es in der Umsetzung noch zu viele Probleme auf, wie Redakteurin Chavie Lieber in einem Artikel für Business of Fashion bemerkte. Für das Branchenmagazin testete sie fünf verschiedene Plattformen und bemängelte insbesondere deren Auswahl, aber auch die Verfügbarkeit der Kleidung. So würde man nicht immer die Stücke zugesendet bekommen, die man sich explizit gewünscht habe, sondern eine Alternative, die auf der eigens erstellten Wunschliste gespeichert worden sei. Auch kritisierte sie, dass es den Großteil der Kleidung nur in kleineren Größen angeboten werden würde — zumindest körperliche Diversität wird in solchen Fällen also ausgeschlossen. Blickt man außerdem auf das Angebot einiger Miet-Services, so wird schnell deutlich, dass dieses nicht immer auf die eigentliche Zielgruppe, also jene Personen, die durchaus auch Trends tragen, aber gerne nachhaltiger werden möchten, abgestimmt ist. Stattdessen werden hier etwa simple T-Shirts und Kleider angeboten, die einen geringeren Anreiz haben.
Gibt es das eine, richtige Konzept?
Kann die Zukunft der Mode trotz unausgereifter Konzepte aber dennoch im Mieten liegen? Zweifellos hat der Service seinen Reiz, für eine wirkliche Konkurrenz zum klassischen Verkauf dürfte es aber noch an der mangelnden Umsetzung scheitern. Mit hohen monatlichen oder einmaligen Gebühren sind sie oftmals zu teuer, während die Auswahl nicht groß genug und die Verfügbarkeit nicht ausreichend ist. Ob einzelne Personen tatsächlich einen Anreiz haben, 300 Euro für einen Designer-Mantel (Neupreis etwa 1400 Euro) auszugeben, um diesen einen Monat lang tragen zu können, ist fraglich, insbesondere dann, wenn man beginnt, zwischen Miet- und Neupreis abzuwägen. Hinzu kommt der Besitzanspruch, den viele Menschen hegen, wie Eugene Rabkin, Redakteur des StyleZeitgeist Magazins, anmerkte und betonte, dass viele Leute eine Lust, ja gar ein lang anhaltendes Vergnügen am Besitz verspüren, das beim Vermieten ausbleiben würde — ein Faktor, der das Miet-Konzept zusätzlich erschwert. Wird es außerdem durch den Nachhaltigkeitsgedanken getragen, ergibt sich spätestens hier ein weiterer Nachteil: Stücke, die über Webseiten vermietet werden, müssen mindestens zwei Mal per Post verschickt werden, während der klassische Online Handel zumindest die Chance mit sich bringt, lediglich einen einzigen postalischen Weg zurückzulegen. Was in der Theorie vielversprechend klingen mag, bräuchte also noch eine Reihe an Veränderungen, um sich tatsächlich durchsetzen zu können.
Die wohl größten, realistischsten Chancen hätte der Miet-Service zum derzeitigen Punkt vermutlich durch moderate Preise sowie eine durchdachte Auswahl und Verfügbarkeit für besondere Anlässe, wie etwa Hochzeiten oder Abendveranstaltungen. Es müssten also Kleidungsstücke und Accessoires sein, die so besonders oder gar ausgefallen sind, dass eine einzelne Person nicht das Verlangen hat, sie zu besitzen. Um die hohe Versandrate zu sparen, gilt das Konzept von H&M, also einen Miet-Service in einen Concept Store zu integrieren, als einzig sinnvolle Variante. Denkbarer erscheint derzeit, dass sich der Konsum verstärkt gen Vintage Mode entwickelt, denn auch wenn noch immer viele Menschen dieselben Stücke tragen möchten, die sie in den sozialen Medien oder in Magazinen sehen, äußert sich vermehrt der Wunsch nach einer individuellen Garderobe, um sich von der Masse abzuheben. Diese Entwicklung lässt sich nicht zuletzt anhand der Vintage und Secondhand Shops, die vermehrt auf den Markt kommen, beobachten. Auch funktioniert Vintage oftmals als eine Art Gegenentwurf zur derzeitigen Übersättigung der Modebranche: Die ständige Möglichkeit, alles sofort per Mausklick bestellen zu können, dürfte in einigen Konsument*innen außerdem das Bedürfnis nach Einzelstücken sowie einer langanhaltenderen Suche nach dem „perfekten“ Kleidungsstück hervorrufen, deren Entdeckung zuweilen eine stärkere Wertschätzung bewirken könnte, als bei Mode, die schnell nebenher konsumiert wird. Letztlich aber wird es wohl kein alleiniges Modell sein, das sich durchsetzen kann. Es braucht vielmehr ein Zusammenspiel unterschiedlicher Konzepte sowie die Bereitschaft von uns allen, auf einzelne, bequeme Aspekte, die etwa der Konsum von Fast Fashion mit sich bringt, zu verzichten − bis dahin bleiben sowohl Miet-Services als auch ein reiner Vintage-Handel wohl wenig massentauglich.
Dieser Artikel erschien bei This is Jane Wayne