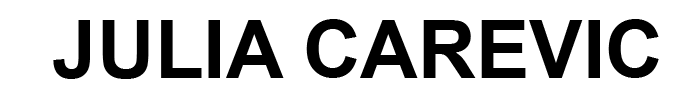(publiziert auf This is Jane Wayne)
Am 14. Oktober 2020 veröffentlichte Netflix die Dokumentation Blackpink: Light Up The Sky — noch am selben Tag schaute ich sie mir, eingerollt in eine Wolldecke, in der linken Hand ein Glas Wein, mit aufgeregtem Gefühl im Bauch an. Die Faszination um die südkoreanische Girlgroup war zu diesem Zeitpunkt längst auf mich übergesprungen und entfachte eine merkwürdige Euphorie in mir, die mich zuweilen in meine Teenie-Zeit zurückversetzte. Bis in die Nacht hinein googelte ich Lisa, Rosé, Jisoo und Jennie, schaute mir ihre catchy Choreografien an (einen kurzen Moment lang überlegte ich sogar, sie vor meinem Spiegel zu performen) und summte den Chorus von How You Like That stundenlang vor mich hin. All das tat ich heimlich, ohne je einer anderen Person davon zu erzählen. Es blieb zunächst mein kleines Geheimnis, denn: Ich schämte mich. Ich schämte mich, weil ich mich als Frau über 30 noch immer von einer klassischen Girlband faszinieren ließ, auf das glänzende Haar starrte und mir vermeintlich „einfache Klänge“ in Dauerschleife anhörte.
Ich schämte mich, weil ich Popmusik hörte, die in der Öffentlichkeit gerne mal verpönt wird und ich obendrein auch noch wesentlich älter als die eigentliche Zielgruppe bin. Kurzum: Es hätte keinen einzigen Grund gegeben, meine Vorliebe tatsächlich kundzutun. Stattdessen genoss ich schweigend.
Und eigentlich war ich sogar ziemlich gut darin, mein Geheimnis für mich zu behalten. Bis es in einem unbedachten Moment eben doch aus mir herausplatzte: „Ja, natürlich kenne ich Blackpink, es gibt ja kaum noch ein TikTok-Video ohne und überhaupt, hast du dir die Doku eigentlich schon angeschaut?“. Erst einige Momente und schiefe Blicke meines Gegenübers später realisierte ich, dass der richtige Zeitpunkt meiner Beichte wohl doch noch nicht gekommen war, und ich tat das, was ich tun musste: Ich schob den Begriff „Guilty Pleasure“ mit einem koketten Lächeln und einem Schulterzucken hinterher und atmete auf — Gottseidank, dieser kleine Zusatz rettete mir gerade noch einmal den Ruf.
Zwischen gut und böse
Guilty Pleasures, so sagen es die New York Times, Wikipedia, das Oxford Dictionary sowie das Urban Dictionary gleichermaßen, sind Dinge, die wir genießen, auch wenn wir wissen, dass wir es entweder nicht mögen sollten oder dass unsere Affinität etwas Negatives über uns aussagen könnte. Und: Besagte Leidenschaft zuzugeben, ist genau deshalb meist mit einem Schamgefühl verbunden. Dabei erstrecken sich Guilty Pleasures über so ziemlich alle Bereiche: Oftmals zählen hierzu neben Filmen und bestimmten TV-Programmen auch Bücher, ganze Musikgenres oder aber auch Lebensmittel, die als ungesund gelten. „Praktisch“ sagen die einen, „problematisch“ die anderen, denn während wir uns durch den Begriff in eine neutrale Schutzzone retten, sorgen wir gleichzeitig dafür, nicht aus der gesellschaftlich anerkannten Reihe zu tanzen. Wir machen uns auf diese Weise unangreifbar, immerhin würden wir besagte Dinge bloß ironisch mögen, es sei ja nicht unser „wirklicher Geschmack“ und das, so schrieb der Autor Niko Kappel einst, sei nun einmal „meist angesehener“. Problematisch sei das aber erst, wenn Guilty Pleasures eine Entschuldigung für einen moralisch fragwürdigen Geschmack seien, etwa im Fall von Germany’s Next Topmodel. Hier nämlich würden „Menschen sagen, dass sie die Sendung mögen, ihnen das aber peinlich“ sei, weil „sie eigentlich wissen, dass dort seit Jahren das Körperbild junger Mädchen zerstört wird“. Bezeichnen wir jedoch all das, was uns peinlich ist, stets unter der „schützenden Hülle des Guilty Pleasure“, führe dies letztlich oft dazu, dass der Diskurs sterbe, so Kappel. Immerhin würden moralisch fragwürdige TV-Shows, Serien oder Filme dann nicht mehr kontrovers diskutiert werden, weil man diese ohnehin nicht mehr erst nehmen würde. Gleichzeitig dient dieser kleine Zusatz natürlich auch einer Abgrenzung von all jenen Menschen, die 50 Shades of Grey, Casting-Shows oder Rebecca Blacks Friday tatsächlich gerne und auf eine ganz unironische Weise mögen.
Guilty Pleasures sind abgeschafft
Teilen die einen Guilty Pleasures in gut und böse ein, wollen die anderen sie gleich gänzlich abschaffen. So beschlossen in der Vergangenheit bereits mehr als eine Person, sich endgültig vom Konzept der „heimlichen Laster“ zu lösen: Im Februar 2014 titelte die New York Times „All of the Pleasure. None of the Guilt.“, in diesem Winter machte eine ganz ähnliche Aussage von Fran Lebowitz die Runde. Die Schriftstellerin nämlich sagte in der Doku-Serie Pretend It’s a City, es gäbe so etwas wie Guilty Pleasures gar nicht — es sei denn, das eigene Vergnügen bestünde darin, Menschen zu töten. Krimis zu lesen oder zwei Schüsseln Spaghetti zu essen gehöre aber ganz sicher nicht dazu. Kurzum: Vergnügen gäbe ihr niemals Schuldgefühle.
Beflügelt von der Einfachheit dieser Aussage, nahm ich mir vor, künftig auch meine Liebe zu kompromissloser Popmusik nicht mehr heimlich und mit Scham zu genießen. Sogar an all die Dinge, die ich bisher nur hinter verschlossenen Türen zelebriert oder als unliebsames Guilty Pleasure abgetan hatte, ging ich in Gedanken durch. Sie allesamt gehörten ganz plötzlich völlig unironisch zu meinem Leben — ganz ohne Schamgefühl, dafür mit einer brandneuen „Ich steh’ dazu“-Attitüde. Aber eben auch mit dem Wissen, dass ich künftig anecke, mit meinem Geschmack, mit meinen Ansichten und Eigenarten. Ob sich über einige Auffassungen und Vorlieben diskutierten lässt? Ganz sicher. Und dennoch fühlt es sich befreiend an, ganz so, wie es Micaela Marini Higgs 2019 in ihrem Artikel für die New York Times verlauten ließ. In diesem Sinne: Hallo, ich bin 32 Jahre alt, besitze ein Stoffschwein, das in meinem Bett schläft, kenne das Musikvideo zu Blackpinks How You Like That auswendig, las einst alle Bücher der Biss-Reihe in Rekordzeit, höre zum Einschlafen Die Wilden Hühner, um mich vor Albträumen zu schützen, kochte stets die wahnsinnig einfache Fertig-Rahmsoße, verschlang Love is Blind in zwei Tagen und habe alle Folgen der Reality TV-Show Vanderpump Rules mindestens zweimal geschaut — und ja, all das mochte ich wirklich gänzlich unironisch.